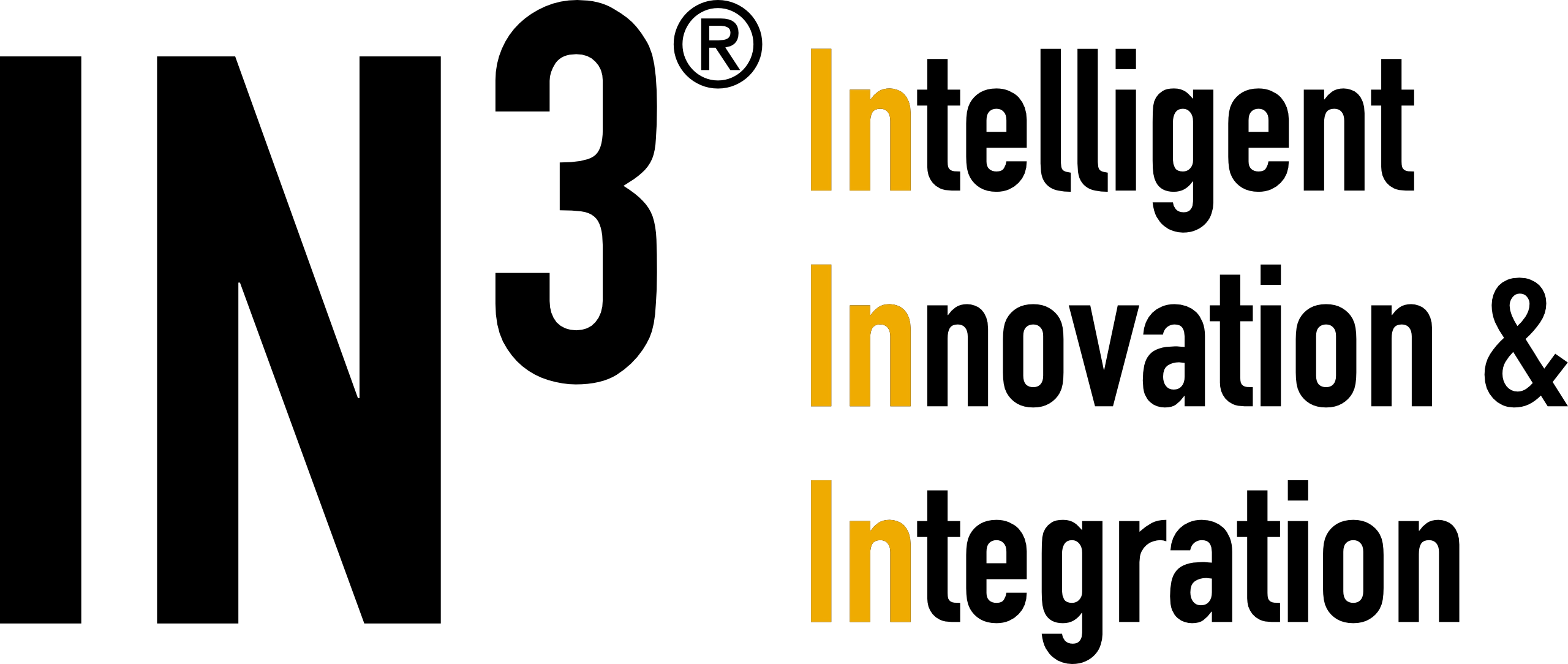Wer in der Prozessimplementierung auf Best Practices setzt, erzielt optimale Ergebnisse. Schließlich orientiert man sich an den Klassenbesten. Ganz einfach. Oder? Warum diese Einstellung sogar gefährlich sein kann und was eine mangelnde Prozessdesign-Kompetenz damit zu tun hat, erklären wir hier.

Viele Unternehmen setzen bei der Implementierung neuer Prozesse in IT- oder Logistikprojekten auf bewährte Methoden, Techniken oder Strategien – sogenannte Best Practices. Der Hauptgrund für diese Entscheidung: Auf den Verantwortlichen lastet ein großer Druck, schnelle Ergebnisse zu erzielen und Projekte risikofrei abzuschließen. SAP hat für S/4 HANA sogar eigene Best Practices entwickelt, die vorkonfigurierte und integrierte Prozesse enthalten. Doch wie sinnvoll sind sie wirklich?
Sehen wir uns zuerst einmal die Vorteile an:
Best Practices sparen Zeit und Ressourcen.
Warum das Rad neu erfinden, wenn man von den Erfahrungen und Methoden erfolgreicher Unternehmen profitieren kann? Wer weniger Zeit in Planung und Umsetzung stecken muss, hat mehr freie Ressourcen für andere Projekte und ist in der Lage, „Painpoints“ schneller zu lösen.
Best Practices vermeiden bekannte Risiken.
Bis Transformationsstrategien zu Best Practices werden, müssen sie sich in verschiedenen Kontexten bewähren. Daher beinhalten sie Erkenntnisse über Fehler, die andere Unternehmen bereits gemacht haben. So können Verantwortliche Stolperfallen von Beginn an ausschließen – ein Scheitern des Projekts wird unwahrscheinlicher.
Best Practices erfüllen die Compliance-Anforderungen.
Bei der Implementierung großer Software-Lösungen, wie zum Beispiel SAP S/4 HANA oder EWM, müssen sich Unternehmen an zahlreiche Compliance-Vorgaben halten. Hier dienen Best Practices als Orientierung, um Verstöße zu vermeiden.
Die „Unique & Differentiating Processes“ eines Unternehmens entscheiden darüber, ob es auch in Zukunft erfolgreich ist. Setzen Entscheider*innen hier unkritisch auf Best Practices, können sie zwar kurze Projektverläufe und geringere Kosten erwarten. Allerdings leidet langfristig die Innovationskraft.
Wo ist dann der Haken?
Best Practices bieten Unternehmen wenig Flexibilität.
Jedes Unternehmen ist mit seinen Prozessen und Strukturen einzigartig. Wie erfolgreich kann da ein „One Size Fits All“-Ansatz sein? Wenn sich die Verantwortlichen strikt an Best Practices halten, nehmen sie dem Unternehmen die Chance, die eigenen individuellen Stärken auszubauen. Außerdem übernehmen die Verantwortlichen häufig Strategien, ohne darauf zu achten, ob diese in ihrem Business-Kontext überhaupt sinnvoll sind.
Best Practices limitieren die Unternehmensperformance.
Best Practices sind Strategien, die die Klassenbesten erfolgreich gemacht haben. Wenn sich andere Unternehmen an sie halten, können sie zu den Standards ihrer Branche aufschließen. Die Kehrseite der Medaille: Sie werden immer nur so gut sein wie die Konkurrenz, und das macht es unmöglich, diese Best-in-Class-Unternehmen zu übertreffen.

Best Practices bremsen Innovation.
Best Practices basieren auf vergangenen Erfahrungen und etablierten Methoden. In einem Marktumfeld, das sich beinahe im Minutentakt verändert, veralten sie aber schnell. Die Folge: Unternehmen laufen Gefahr, neue Trends und Entwicklungen zu übersehen oder sich nicht an die neuen Bedingungen anzupassen.
Best Practices können falsche Sicherheit versprechen.
Wer unhinterfragt auf bewährte Prozesse vertraut, neigt dazu, Risiken für den eigenen Projektverlauf zu unterschätzen oder zu spät zu erkennen. Das kann dazu führen, dass Projektleiter sich nicht kritisch mit möglichen Gefahren auseinandersetzen und wichtige Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel gründliches Testen der Software oder ein konsequentes Risiko-Management, vernachlässigen.
Wann sind Best Practices sinnvoll – und wann nicht?
Viele Projektverantwortliche setzen vor allem aus zwei Gründen auf Best Practices: aus Kosten- und Zeitdruck sowie einer immer geringer werdenden Prozess-Designkompetenz innerhalb der Unternehmen. Es ist schlicht nicht transparent genug, welche Prozesse wirklich Mehrwert bringen und wie sie gestaltet sein müssen, damit sie auf die Unternehmensziele einzahlen.
Doch genau diese „Unique & Differentiating Processes“ entscheiden darüber, ob das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich ist. Setzen Entscheider*innen hier unkritisch auf Best Practices, können sie zwar meist kurze Projektverläufe und weniger Kosten erwarten. Allerdings leidet langfristig die Innovationskraft.
Natürlich gibt es Ausnahmen: Standardprozesse, wie zum Beispiel Finanz- und Buchhaltungsprozesse, sind in den meisten Fällen nicht unmittelbar an der Marktdifferenzierung des Unternehmens beteiligt. Hier kann die Orientierung an Best Practices Zeit und Ressourcen sparen und zu schnellen Ergebnissen führen.
In strategischen, richtungsweisenden Transformationsprojekten, die über die Zukunft der Unternehmen entscheiden, muss die Lösung optimal an die individuellen, wertschöpfenden Prozesse angepasst sein. Die Berater*innen und Projektmanager*innen der IN3 wissen, worauf es ankommt. Mithilfe des Goldfield-Ansatzes analysieren sie die Unique & Differentiating Processes bereits vor dem Auftakt, finden mit den Kunden gemeinsam die dazu passende Lösung und planen das Projekt entsprechend. Kontaktieren Sie uns jetzt!